 Die kooperative Praxis“(„Collaborative Law – CL”) ist ein Ansatz für ein ganzheitliches Anwaltsmandat mit integrierter Mediation. Werner Schieferstein (Foto rechts) präsentierte diese klientenfreundliche Art der anwaltlichen Vertretung auf der Veranstaltung „Mediation verbinden“ am 28. November in Koblenz.
Die kooperative Praxis“(„Collaborative Law – CL”) ist ein Ansatz für ein ganzheitliches Anwaltsmandat mit integrierter Mediation. Werner Schieferstein (Foto rechts) präsentierte diese klientenfreundliche Art der anwaltlichen Vertretung auf der Veranstaltung „Mediation verbinden“ am 28. November in Koblenz.
Was waren die Anfänge?
Kooperative Praxis ist sozusagen von zwei Enden her entstanden: Als Anwälte mit Mediationserfahrung hatten wir keine Lust mehr, im Namen der Parteien aufeinander einzudreschen. Und als Mediatoren mit anwaltlicher Praxis hatten wir keine Lust mehr, den rechtlichen Teil an unbekannte Anwälte abzugeben, die das Ganze möglicherweise nicht richtig verstehen und so den Streit wieder neu entfachen. Wir wollten die Sache in einer Hand behalten. So übernehmen wir den rechtlichen Teil als Anwälte – und im persönlichen emotionalen Konflikt treffen wir uns gemeinsam und versuchen, den Konflikt als Mediatoren zu lösen.
Auf diese Weise behalten wir die Führung im gesamten kooperativen Prozess. Erst später haben wir erfahren, dass die kooperative Praxis schon eine internationale Bewegung ist und beispielsweise in den USA einen festen Platz in der juristischen Landschaft hat (dort heißt es „Cooperative Practice“ oder „Collaborative Law“ CL;). Wir haben in Frankfurt einen Verein gegründet („Anwaltliches Netzwerk für kooperative Praxis und Mediation – AN.KOM e.V.) und sind dabei, ein regionales Netzwerk mit Anwälten aufzubauen, die mit der kooperativen Praxis arbeiten, siehe auch unsere Website: www.an-kom.de
Was ist „kooperative Praxis“?
Kooperative Praxis ist eine Verbindung von Anwaltsvertretung und Mediation. Die Grundlage ist jeweils ein – konventionelles – Anwaltsmandat für jede Seite, jedoch mit der Besonderheit, dass mit den Parteien eine kooperative Anwendung des Rechts vereinbart wird. Dies geschieht in einer Zusatzvereinbarung zur allgemeinen Vollmacht. Darin verpflichten sich Parteien und Anwälte zu einem kooperativen Vorgehen in der rechtlichen Auseinandersetzung, d.h. auch zur Kooperation mit der Gegenseite. Wörtlich: „Mit der Unterzeichnung dieser Bedingungen setzen sich die Parteien dafür ein, das Recht nicht zur Durchsetzung einseitiger Vorteile auf Kosten des anderen zu benutzen, sondern mit den Rechtslösungen zugleich Konfliktlösungen anzustreben. Gegenstand dieses Auftrags ist es daher, Kooperation und Einigung im Rahmen des Rechts zu suchen. Hierzu versprechen sowohl Rechtsanwalt wie Mandant/In, sich nach Möglichkeit um Verständigung und Vermittlung mit der Gegenseite zu bemühen.“ Voraussetzung ist, dass beide Seiten diese Zusatzvereinbarung „spiegelbildlich“ abschließen, denn Kooperation ist nur möglich, wenn beide Seiten sich in gleicher Weise darauf verständigen. Die rechtliche Vertretung des Mandanten ist also eine parteiliche Vertretung mit der Maßgabe, das Recht „kooperativ“, d.h. nicht zur Durchsetzung einseitiger Vorteil auf Kosten des anderen anzuwenden. Soweit die rechtliche Basis. Wie kommt nun die Mediation in das Verfahren? Man könnte sagen, das Parteimandat hindert die Anwälte daran, in der gleichen Person auch Mediatoren zu sein. Der scheinbare Widerspruch zwischen Parteilichkeit und Unparteilichkeit löst sich dadurch, dass wir in der kooperativen Praxis zwischen Rechtsberatung und/oder –vertretung und der Konfliktlösung – oder wie man auch sagt: der „Konfliktbearbeitung“ unterscheiden. Was das Recht betrifft, sind wir Anwälte in der kooperativen Praxis immer parteilich, wenn auch im Rahmen einer Kooperation, – was den Konflikt betrifft handeln wir als Mediatoren, also unparteilich – oder wie man auch sagt: „allparteilich“. In den besonderen Mandatsbedingungen heißt es dazu wörtlich: „Zur Förderung von gemeinsamen Lösungen kann der Rechtsanwalt Methoden und Techniken der Mediation anwenden, ohne dadurch jedoch als Mediator „neutral“ für beide Seiten aufzutreten“. Und: „Juristisch berät und vertritt der Rechtsanwalt stets nur seine eigene Partei. Eine rechtliche Beratung der Gegenpartei findet – selbst zur Ermöglichung einer gemeinsamen Lösung – in keinem Fall statt.“ Wir müssen hier also nicht nur differenzieren zwischen dem juristischen und dem mediatorischen Teil der kooperativen Praxis, der vom jeweiligen Thema oder Gegenstand abhängt, sondern auch zwischen dem Basisauftrag und (im Grunde) der Methodik. Der Basisauftrag ist in der kooperativen Praxis immer das Anwaltsmandat. Die Methodik dagegen folgt den Prinzipien der Mediation. Aus diesem Grund haben wir in den besonderen Mandatsbedingungen den Anwalt auch nicht „Mediator“ genannt, damit die Mediatorenrolle nicht irreführend auf das ganze Verfahren bezogen wird. Die Basis ist immer das Anwaltsmandat. Im „Konflikteil“ handeln wir dagegen – und dies ist ein besonderer Auftrag, wo wir auch nach Stundensatz abrechnen – als Mediatoren. Wenn wir also einfach nur sagen, „wir machen beides“ ,könnte das in der Tat für Verwirrung sorgen, da es dann den Anschein haben könnte, dass wir beides miteinander vermischen. Das Gegenteil ist aber der Fall: Wir sagen jeweils immer genau, was wir machen, in welcher Rolle wir sind. Das Besondere des Verfahrens ist gerade die Klarheit der Rolle, bezogen auf das jeweilige Thema. Das ist übrigens in der „reinen Mediation“ durchaus nicht immer der Fall: Der Mediator, wenn er Anwalt oder auch Richter ist, gibt implizit oder explizit gerne immer mal „ein paar Hinweise, wie es gemacht wird“. alles in der Rolle des Mediators, obwohl er dann wie ein Berater handelt oder verstanden wird. Es empfiehlt sich auch, den Mandanten immer zu signalisieren, was man tut, zumindest, auf eine solche Nachfrage immer eine klare Antwort geben zu können. Zum Beispiel: „Ich bin jetzt Ihr Anwalt. Ich rede über das Recht.“ Oder „Ich handele jetzt in der Rolle des Mediators, d.h., ich versuche zu verstehen, was Ihre Interessen hinter ihren Rechtsansprüchen („Positionen“) sind. Wichtig ist es auch, sich hierfür stets das Einverständnis der eigenen Partei zu einzuholen: „Sollen wir jetzt über das Recht reden?“ Oder: „Sind Sie einverstanden, dass wir jetzt versuchen, Ihren Konflikt verstehen?“ Auch dies ist in der „reinen Mediation“ nicht der Fall. Denn da ist man ja „immer Mediator“, egal, was man tatsächlich tut. Diese Abstimmung mit der eigenen Partei haben wir in den besonderen Mandatsbedingungen so festgehalten: „Der/die Mandant/In verspricht, vertrauensvollen Kontakt mit dem Rechtsanwalt zu halten und etwaige Vorbehalte gegen einen kooperativen Umgang mit der Gegenpartei diesem umgehend mitzuteilen.“ Dass der Rechtsanwalt dies ebenso verspricht, ergibt sich als Selbstverständlichkeit bereits aus dem Mandatsverhältnis. Den hier bisweilen vorgebrachten Einwand, ein solcher Rollenwechsel könnte als „Parteiverrat“ (miss)gedeutet werden, kann man leicht widerlegen. Der Rechtsanwalt ist „Interessenvertreter“ (so steht es auch in der Berufsordnung) – und nicht „Positionsvertreter“. Ein „Positionsvertreter“ wäre gem. der Terminologie der Mediation ein Anwalt, der seine Partei nur im Rahmen einer festgelegten, starren Position vertritt, eine bestimmte Forderung durchzusetzen, egal was es kostet. Genau dies ist jedoch nicht das Interesse der „kooperativen Praxis“, sondern das Mandat verfolgt das Ziel, eine Kooperation herzustellen. Das Interesse ist also, über eine Kooperation ein Ergebnis zu erzielen, und zwar eines, mit dem möglichst beide Seiten (gleich) zufrieden sind. Im Rahmen der Kooperation ist der Anwalt frei in der Wahl seiner Methoden. Auch dies steht so in der Berufsordnung – § 1 BORA – , wonach der Rechtsanwalt seine Partei „rechtsgestaltend, konfliktvermeidend und streitschlichtend“ zu begleiten hat, ohne dass ihm hierzu eine bestimmte Verfahrensart vorgeschrieben wird. Der betreffende Passus der Berufsordnung ist zu Beginn der Besonderen Mandatsbedingungen wörtlich zitiert. Er bildet sozusagen die standesrechtliche Legitimation zur „kooperativen Praxis“.
Vorbereitung Einzelgespräch
Soviel erst einmal zu den theoretischen Grundlagen des Konzepts. Wie nun installiert man das Verfahren in der Praxis? Hier gibt es verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, auf die ich nicht alle eingehen möchte, – Sie könnten später fragen. Nehmen wir also einmal den einfachsten Fall, den wir Standardfall nennen (auch wenn er das nicht ist): Wir haben einen Mandanten, der die kooperative Praxis wünscht, weil wir sie ihm vorher erklärt haben, – und die Gegenpartei ebenso: Sie wird von einem Kollegen, einer Kollegin vertreten, der/die ebenfalls nach der kooperativen Praxis arbeitet. Wir beraten – = das Erstgespräch – in verschiedenen Stufen.
- Zunächst das bloße Recht. Da die Auseinandersetzung im Rahmen der Kooperation stattfinden soll, beraten wir hier anders als wohl der klassische Anwalt. Dieser könnte etwa sagen: Nach der Rechtslage haben Sie die und die Ansprüche, – die setzen wir durch, das kriegen wir hin! Die Verabredung in der kooperativen Praxis ist jedoch anders, denn wir suchen die Kooperation mit der anderen Seite und nicht den Krieg. Also beraten wir nach Minimal- und Maximalforderungen, klären jeweils über die besonderen Vor- und Nachteile, also die Risiken auf. Bei Maximalforderungen ist das einleuchtend: Stellen wir überzogene Forderungen, wird das die Gegenseite genauso tun, und wird zu einer Kooperation nicht bereit sein. Das Verfahren wird also nicht funktionieren. Stellen wir zu geringe Forderungen, könnte diese von der anderen Seite dahingehend missverstanden werden, dass man das Feld räumt. Dazu braucht man keinen Anwalt, das könnte man auch allein. (Harvard-Konzept). Es geht um die so genannte „Augenhöhe“. Nur wo eine gleichwertige Achtung da ist, kann gegenseitiger Respekt entstehen. Nur wo ein gegenseitiger Respekt geschaffen ist, kann es faire Lösungen geben. Unsere Rechtsberatung fokussiert sich also nicht auf einen bestimmten Anspruch sondern klärt über die Bandbreite des Rechts auf. Da es eine parteiliche Beratung ist, kann es gut sein, dass die Anwälte zu unterschiedlichen Rechtsauffassungen kommen und diese auch gegenüber dem anderen Kollegen vertreten. In diesem Punkt unterscheidet sich die Rechtsberatung kaum von Rechtsberatung anderer Anwälte.
- Kooperation im Recht: Die Vereinbarung der kooperativen Praxis setzt voraus, dass die Parteien sich zur Kooperation verpflichten und selbst dafür eintreten. Die Anwälte erläutern die Vorteile (und auch Risiken) der Kooperation. Die Parteien müssen aber selbst die Verantwortung für ihre Kooperationsentscheidung übernehmen. Dies unterscheidet die kooperative Praxis von herkömmlichen Empfehlungen an die Konfliktparteien zur Zusammenarbeit, wobei die Streitenden im Zusammenhang des Verfahrens genau bedeutet.
Was ist der Konflikt unabhängig vom Recht, bzw. der Konflikt der darunter liegt? Was steht hinter dem Recht? Das ist die Frage nach den Interessen, ganz wie in der Mediation. Über die Interessenklärung zeichnet sich der Kooperationsrahmen ab. Ich frage hier gern nach der „Gegenpartei“, hole mir sie durch meine Fragen (zirkuläre Fragen) virtuell in den Raum. Z.B. : „Was würde Ihre Frau/ Ihr Mann sagen, wenn…?“ Aber ich frage auch nach besonderen Konfliktsituationen, die noch aktiv sind, und nach Konfliktmustern. Dieser Teil des Erstgesprächs hat deutlich mediative Züge. Ich betrachte es als eine Vorbereitung zu einem „Coaching“, – auch wenn ausgebildete Coachs mir da widersprechen dürften. Denn dieser Teil der Klärung des Konflikts aus einer Sicht geht dann über in einen dritten Teil:
Ansprechen von Strategien (Coaching). Strategische Erwägungen gelten oft als nicht offen, als berechnend, haben keinen guten Ruf. Hier geht es jedoch darum, die gewonnen Fakten sinnvoll in ein Verhandlungskonzept einzubinden, – Verhandlung im Sinne des Harvard-Konzepts, eines rationalen, nicht intuitiven Verhandelns. Zur Erinnerung: „Klar/hart in der Sache, freundlich zu den Menschen“. Strategische Erwägungen sind jedenfalls nicht grundsätzlich unfair. Denken wir an den Fußball oder den Sport überhaupt: Dort geht ohne Strategien nichts. Wir könnten also präzisieren: Es geht um die Auslotung fairer, kooperativer Strategien. Ein Beispiel: Ein Mandant im Unterhaltsstreit. Er verdient im Moment nicht viel, hat aber etwas geerbt, – dies würde er mit einsetzen, – aber nicht vorweg, sondern als Verhandlungsspielraum.
Nach diesem Gespräch hat man folgendes erreicht: Die Partei wurde über das Recht informiert, genauer den rechtlichen Rahmen, in dem etwas geschehen kann. Man hat etwas über den Konflikt und die Sichtweise des Mandanten dazu, auch seine persönliche Meinung über den / die Kontrahenten/Partner. Man kann nun einen Plan / eine Tagesordnung für das mediative 4-er Treffen entwerfen. Diesen Entwurf einer Tagesordnung schickt man an die Gegenseite, um sie mit ihr abzustimmen. Möglich ist hier auch ein Telefonat, um der Gegenseite mitzuteilen, wo man steht.
4-er Gespräch / Mediationsteil
Nun laufen alle drei Stränge parallel: Recht, Coaching, und Mediation/Ko-Mediation. Nachbesprechung, Coaching…
Kosten
normale Anwaltsgebühren, RVG, und für den Mediationsteil Stundensatz.
Die Prinzipien der kooperativen Praxis
Das Verfahren ist in den „besonderen Mandatsbedingungen“ definiert und wurde von den Parteien durch ihre Unterschrift akzeptiert. Damit das Verfahren im Sinne der unterzeichneten Bedingungen praktisch umgesetzt werden kann, sind folgende Grundsätze zu beachten:
Offenheit:
Die Parteien verpflichten sich, alle Fakten offenzulegen, die für eine einvernehmliche und nachhaltige Einigung nötig erscheinen.
Vertraulichkeit:
Zur Gewährleistung eines Vertrauensschutzes für das Verfahren der kooperativen Praxis, d.h. damit Informationen, die im Rahmen eines vertraulichen Gesprächs preisgegeben werden, bei einem Scheitern der Verhandlungen nicht zum Schaden der anderen Seite verwendet werden können, erklären die Parteien für den Fall eines späteren gerichtlichen Streitverfahrens Einverständnis darüber,· dass die beteiligten Anwälte nicht als Zeugen benannt werden,· dass die beteiligten Parteien darin keine Informationen verwenden, die in den Verhandlungen der kooperativen Praxis vertraulich eingebracht wurden. Als vertraulich gelten dabei – abgesehen von solchen Informationen, die ausdrücklich als vertraulich gekennzeichnet wurden – insbesondere alle persönlichen Belange, sowie Kunst- und Gewerbegeheimnisse. Die Beteiligten verpflichten sich insoweit zur Verschwiegenheit und erklären, dass eine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht nur gemeinsam durch beide Vertragspartner, bzw. ihrer Vertreter im vorangegangenen kooperativen Praxis erfolgen kann, und dass eine Nichtentbindung von der Verschwiegenheitspflicht nicht in einem nachfolgenden Rechtsstreit als Beweisvereitelung gewertet werden kann.
Freiwilligkeit:
Die Parteien können das Verfahren der kooperativen Praxis jederzeit beenden. Sie versprechen jedoch für den Fall einer beabsichtigten Beendigung, diese zum gemeinsamen Thema zu machen und das weitere Verfahren abzusprechen, wenn es bei dem Beendigungsentschluss bleibt.
Eigenverantwortung:
Die Parteien tragen für die Bereitschaft zur Kooperation die eigene Verantwortung, d.h. sie machen diese nicht von der Gegenseite oder den Anwälten abhängig. Dadurch wird gewährleistet, dass jede Seite sich nach besten Kräften selbst für das Gelingen der Kooperation einsetzt. Die Anwälte setzen sich insofern nur für die Interessen der Parteien ein und fördern diese.


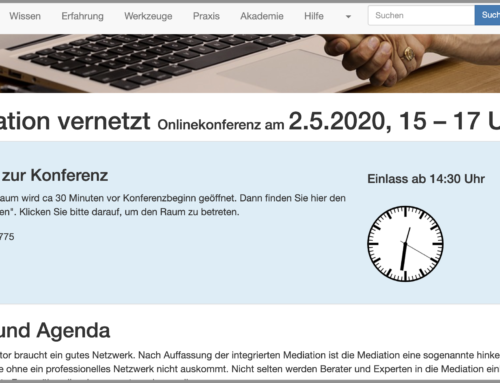

Hinterlasse einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.